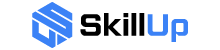Immer mehr Forscher lassen KI für sich schreiben: Was das wirklich bedeutet – und wie wir es sinnvoll nutzen
Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in die Wissenschaft und unterstützt Forschende zunehmend beim Schreiben. Von der Ideenfindung bis zur Formatierung bieten KI-Tools vielfältige Möglichkeiten. Doch welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus? Und wie lässt sich KI sinnvoll nutzen, ohne die wissenschaftliche Qualität zu gefährden?
Warum KI in der Forschung durchstartet
Zwei Faktoren spielen eine entscheidende Rolle: Erstens liefern KI-Modelle mittlerweile qualitativ hochwertige Texte – schnell und mehrsprachig. Zweitens eignen sich die textbasierten Arbeitsprozesse in der Wissenschaft ideal für KI-Unterstützung. Konferenzen wie INCONECSS 2025 bestätigen den Einfluss von KI auf den Forschungsalltag, von der Datenanalyse bis zur Textproduktion. Auch die Open-Science-Community diskutiert die Vorteile von KI, beispielsweise beim Schreiben, Übersetzen und der Verbesserung der Barrierefreiheit.
Was Forscher schon heute mit KI machen
- Ideen strukturieren: KI hilft, Notizen zu gliedern, Thesen zu ordnen und Hypothesen zu präzisieren.
- Schreiben und Überarbeiten: KI kann Texte sprachlich verbessern, insbesondere für Forschende, deren Muttersprache nicht Englisch ist.
- Übersetzen: KI ermöglicht hochwertige Übersetzungen von Abstracts, Cover Letters und Präsentationen.
- Literatur erschließen: KI unterstützt bei der Literaturrecherche, Zusammenfassung von Artikeln und Erstellung von Related-Work-Abschnitten.
- Barrierefreiheit und Reichweite: KI generiert automatische Untertitel, Audioversionen und Bildbeschreibungen.
Diese Vorteile sind real, erfordern aber einen bewussten Umgang mit der Technologie.
Die wichtigsten Chancen
- Mehr Fokus auf das Wesentliche: KI beschleunigt Routinearbeiten und schafft Freiraum für Forschungsideen und Diskussionen.
- Bessere Verständlichkeit: KI unterstützt die klare Kommunikation von Forschungsergebnissen.
- Inklusion und Zugang: KI erleichtert die Forschung für Nicht-Muttersprachler und Menschen mit Behinderungen.
- Forschungssupport 2.0: Bibliotheken entwickeln KI-basierte Dienste für Forschende.
Die größten Risiken
- Fehlende Nachvollziehbarkeit: Die Funktionsweise vieler KI-Modelle ist undurchsichtig, was zu Fehlern und „Halluzinationen“ führen kann.
- Verlust von Kompetenz: Übermäßiges Vertrauen auf KI kann die Schreib- und Analysefähigkeiten schwächen.
- Ungleichheit durch Bezahlschranken: Leistungsstarke KI-Tools sind oft kostenpflichtig.
- Abhängigkeit vom Prompting: Gute Ergebnisse erfordern präzise Anweisungen an die KI.
- Ethik und Urheberrecht: Fragen der Autorenschaft, Datenquellen und Richtlinienkonformität müssen geklärt werden.
So nutzt du KI beim wissenschaftlichen Schreiben verantwortungsvoll
- Rolle der KI offenlegen: Transparenz schaffen, indem du angibst, wofür die KI eingesetzt wurde.
- Qualität sichern: Die KI als Assistent, nicht als Autor nutzen. Alle Aussagen und Quellen prüfen.
- Daten- und Richtlinienkonformität: Datenschutz beachten und Journal-Richtlinien prüfen.
- Fairness und Zugänglichkeit: KI nutzen, um Barrieren abzubauen und Übersetzungen oder alternative Formate bereitzustellen.
- Prompting als Forschungsskill: Präzise Anweisungen an die KI formulieren und iterativ verbessern.
- Zusammenarbeit mit Bibliotheken: Beratungs- und Schulungsangebote nutzen.
Was bedeutet das für Open Access und die Forschungsöffentlichkeit?
KI kann Open Science fördern, indem Inhalte schneller zugänglich und vielfältiger aufbereitet werden. Gleichzeitig müssen faire Zugänge zu KI-Tools gewährleistet sein.
Konkrete Praxis-Tipps
- Struktur-Start: Alternative Gliederungen mit KI generieren.
- Related Work effizienter: KI für Zusammenfassungen nutzen, aber Originale lesen.
- Klartext statt Kauderwelsch: Klare Stilvorgaben für die KI definieren.
- Methodenabschnitt schärfen: KI zur Identifikation potenzieller Fehlerquellen nutzen.
- Transparenz-Statement: KI-Nutzung im Paper dokumentieren.
- Barrierefreiheit: Alternativtexte für Abbildungen und leicht verständliche Zusammenfassungen erstellen.
Wie verändert das die Rollen in der Wissenschaft?
- Forschende: Fokus auf Fragestellung, Methode und Interpretation.
- Bibliotheken/Research Support: Unterstützung bei Workflows und Tools.
- Herausgeber und Reviewer: Richtlinienüberwachung und Faktenprüfung.
- Lehrende: Vermittlung von KI-Kompetenzen.
Worauf es jetzt ankommt
- Klarheit statt Verbot: Transparente und qualitätsgesicherte Nutzung von KI fördern.
- Kompetenzaufbau: Schlüsselqualifikationen im Umgang mit KI vermitteln.
- Infrastruktur: Sichere und regelkonforme KI-Tools bereitstellen.
- Offene Wissenschaft stärken: KI für die Verbreitung von Wissen nutzen.
Fazit: KI im wissenschaftlichen Schreiben ist kein Trend, sondern eine logische Entwicklung. Mit klaren Regeln und kritischem Umgang lässt sich KI sinnvoll nutzen, um Forschung schneller, verständlicher und zugänglicher zu machen. Die Verantwortung bleibt beim Menschen.