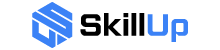Im Laufe des Lebens denken viele Menschen darüber nach, wie sie im Fall einer sc
Im Laufe des Lebens denken viele Menschen darüber nach, wie sie im Fall einer schweren Erkrankung oder plötzlichen Entscheidungsunfähigkeit versorgt werden möchten. Zwei wichtige Dokumente helfen dabei, Wünsche und Entscheidungen rechtzeitig festzulegen: die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Beide greifen in schwierigen Situationen, sind aber ganz unterschiedlich aufgebaut und regeln verschiedene Dinge. Hier erfahren Sie, worin die Unterschiede liegen, was genau in den jeweiligen Dokumenten festgelegt wird – und warum es sinnvoll ist, beides zu haben.
Was regelt die Patientenverfügung?
Die Patientenverfügung ist ein schriftliches Dokument, in dem jemand festhält, wie er oder sie medizinisch behandelt werden möchte, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es zum Beispiel darum, ob lebensverlängernde Maßnahmen, wie künstliche Beatmung oder Ernährung, gewünscht oder abgelehnt werden. Vor allem bei schweren Krankheiten oder Unfällen, die zu Bewusstlosigkeit oder dauerhafter Entscheidungsunfähigkeit führen, bestimmt die Patientenverfügung, welche Behandlungen erfolgen sollen und welche nicht.
Ein zentraler Punkt ist, dass die Patientenverfügung verbindlich ist, wenn sie ausreichend konkret formuliert wurde und auf die aktuelle Situation passt. Ärzte, Pflegende und die Vertrauenspersonen orientieren sich daran, um den Willen der betroffenen Person zu respektieren. So schützt die Patientenverfügung die Selbstbestimmung und verhindert, dass Entscheidungen gegen den eigenen Wunsch getroffen werden.
Was regelt die Vorsorgevollmacht?
Die Vorsorgevollmacht ist ein anderes, aber ebenso wichtiges Dokument. Damit bevollmächtigt man eine oder mehrere vertrauenswürdige Personen, im eigenen Namen wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist – etwa wegen Krankheit oder Unfall. Diese Personen können Familienmitglieder, Freunde oder andere Vertraute sein.
Die Vorsorgevollmacht deckt viele Bereiche ab:
- Gesundheitsfragen, wie die Einwilligung oder Ablehnung von medizinischen Maßnahmen, wenn der Patient dies nicht mehr selbst sagen kann.
- Vermögensangelegenheiten, etwa das Verwalten von Konten, Bezahlen von Rechnungen oder das Verwalten von Immobilien.
- Organisatorische und persönliche Anliegen, zum Beispiel Entscheidungen über Wohnortwechsel, Umzug ins Pflegeheim oder Beantragung von Sozialleistungen.
Der große Vorteil der Vorsorgevollmacht ist, dass eine fremde, vom Gericht bestellte Betreuerin oder ein Betreuer vermieden wird. Denn ohne Vorsorgevollmacht entscheidet unter Umständen ein Gericht über die Person, die für Sie handelt – oft eine unbekannte Berufsbetreuerin oder ein Berufsbetreuer. Mit der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie selbst eine Vertrauensperson, die Ihren Willen kennt und umsetzt.
Wesentliche Unterschiede im Überblick
| Aspekt | Patientenverfügung | Vorsorgevollmacht |
|---|---|---|
| Inhalt | Festlegung konkreter Wünsche zur medizinischen Behandlung | Bestimmung einer Vertrauensperson für Entscheidungen |
| Geltungsbereich | Medizinische Maßnahmen und Behandlung | Medizinische, finanzielle und persönliche Angelegenheiten |
| Wann aktiv | Wenn die Person nicht mehr einwilligungsfähig ist | Wenn die Person nicht mehr entscheidungsfähig ist |
| Wer handelt | Ärzte und Pflege im Sinne der festgehaltenen Wünsche | Vom Bevollmächtigten, der im Namen handelt |
| Notwendig für | Selbstbestimmung bei medizinischen Eingriffen | Vertretung bei vielfältigen Belangen inklusive Medizin |
Warum sind beide Dokumente sinnvoll?
Die Patientenverfügung legt Ihre Wünsche zu medizinischen Behandlungen fest, sagt aber nicht aus, wer sich um die Umsetzung kümmert. Hier kommt die Vorsorgevollmacht ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass jemand da ist, der Ihre Patientenverfügung durchsetzt, mit Ärzten spricht und auch andere Entscheidungen rechtlich wirksam trifft. Ohne eine Vorsorgevollmacht kann es schwierig werden, Ihren Willen umzusetzen, weil ohne Bevollmächtigten oft ein Gericht eingeschaltet wird.
Darüber hinaus regelt die Vorsorgevollmacht viele Bereiche, die in der Patientenverfügung nicht angesprochen werden, zum Beispiel Ihre finanziellen Angelegenheiten oder die Organisation Ihres Alltags.
Sie ergänzen sich also ideal: Die Patientenverfügung gibt klare Anweisungen, was medizinisch gewünscht ist, die Vorsorgevollmacht sichert, dass jemand diese Wünsche kennt, versteht und im Zweifel auch durchsetzen kann.
Was passiert ohne diese Dokumente?
Fehlen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, entscheidet im Ernstfall ein Gericht, wer Ihre Angelegenheiten regelt – häufig eine fremde Person, die Sie nicht kennen. Dadurch kann es zu Verzögerungen, Unsicherheiten und Entscheidungen kommen, die nicht Ihrem Willen entsprechen.
Auch Angehörige müssen oft aufwendig um Zustimmung werben, was in emotional schwierigen Momenten zu Konflikten führen kann. Beides lässt sich durch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung vermeiden.
Wie erstellt man die Dokumente?
Beide Dokumente sollten schriftlich verfasst werden. Die Patientenverfügung muss so genau wie möglich beschreiben, welche Behandlungen Sie befürworten oder ablehnen. Die Vorsorgevollmacht sollte genau angeben, wer bevollmächtigt wird und für welche Bereiche.
Es ist sinnvoll, beides gemeinsam zu erstellen und sich dabei beraten zu lassen, zum Beispiel von Ärztinnen, Rechtsanwältinnen oder spezialisierten Beratungsstellen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche klar formuliert und gesetzeskonform sind.
Fazit
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht regeln unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Dinge. Die Patientenverfügung bestimmt, was mit Ihnen im Notfall medizinisch passieren soll. Die Vorsorgevollmacht bestimmt, wer Ihre Interessen insgesamt vertritt und Ihre Wünsche auch durchsetzt.
Um im Ernstfall wirklich abgesichert zu sein, sind daher beide Dokumente wichtig. Sie ermöglichen, dass Sie selbstbestimmt und gemäß Ihren Vorstellungen versorgt werden – auch wenn Sie selbst keine Entscheidungen mehr treffen können. Daher empfehlen wir, frühzeitig über diese Vorsorgedokumente nachzudenken und sie sorgfältig zu regeln. So schaffen Sie Sicherheit für sich und Ihre Angehörigen.